10 Jahre „Wir schaffen das“ - Von leiser Kritik und lautem Widerspruch: Die Standhaften

Zehn Jahre Angela Merkels „Wir schaffen das“, zehn Jahre lang unkontrollierte, illegale Migration. Auffällig viele Prominente, die sich damals äußerten – positiv bis enthusiastisch, nur wenige kritisch bis ablehnend – schweigen heute. Etliche Anfragen der Berliner Zeitung blieben unbeantwortet.
Alice Schwarzer, die Grand Dame des Feminismus, die heute vor allem wegen ihrer klaren Haltung zum Islamismus von manchen als Rassistin angefeindet wird, hat uns jedoch geschrieben. Ebenso Boris Palmer, das frühere Entfant terrible der Grünen aus Tübingen, der jüdische Historiker Michael Wolffsohn, der Ex-SPD-Chef und damalige Vizekanzler Sigmar Gabriel und last but not least: Heinrich Bedford-Strohm, evangelischer Theologe und langjähriger Kirchenfunktionär. Er ist in der langen Reihe von Namen, die die Berliner Zeitung zehn Jahre danach anfragte, der Einzige, der an seiner positiven Haltung zu Merkels „Wir schaffen das“ festhält. Er sagt: „Es war genau der richtige Satz. Genau der Satz, den man von einer Kanzlerin erwarten muss.“
Alice Schwarzer
Bereits 2015 warnte Alice Schwarzer vor den Risiken einer unkontrollierten Flüchtlingspolitik: „Da kommen Männer aus tief patriarchalen Strukturen, in denen Frauen völlig entrechtet sind, bei denen der politisierte Islam noch Öl ins Feuer gießt und die teilweise traumatische Erfahrungen im Bürgerkrieg gemacht haben.“ Zehn Jahre später habe sie ihre Haltung nicht geändert – vielmehr bedauere sie, recht behalten zu haben, erklärt sie gegenüber der Berliner Zeitung.
In einem aktuellen Editorial ihrer Zeitschrift Emma, das der Berliner Zeitung vorliegt, warnt Schwarzer erneut vor einer schleichenden Unterwanderung demokratischer Werte durch den politischen Islam und wirft Politik wie Gesellschaft vor, das Problem viel zu lange verharmlost zu haben. Nicht „der Islam ist das Problem, sondern der Islamismus“, stellt sie klar – und fordert entschiedenes Handeln. Ihre Warnung ist deutlich: „Der legalistische Islamismus unterwandert seit Jahrzehnten Deutschland. Er muss gestoppt werden!“
Boris Palmer
Er war einer der ersten, die 2015 sagten: „Wir schaffen das nicht.“ Bereits im Oktober des Jahres, also zwei Monate nach Merkels optimistischem Satz, forderte der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer eine radikale Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik, drängte auf Obergrenzen und warnte vor Zeltstädten in Deutschland. Damit stellte er sich – einmal mehr – frontal gegen seine eigene damalige Partei, die Grünen. Inzwischen ist er ausgetreten.
Auch heute, zehn Jahre danach, hält das weiterhin parteilose Stadtoberhaupt aus der südwestdeutsche Universitätsstadt Merkels Ausspruch für einen „verheerenden Fehler“, wie er auf Anfrage der Berliner Zeitung schreibt. Dieser moralischen Aufladung „in Verbindung mit dem bewussten Kontrollverzicht“ sei es geschuldet, „dass die AfD heute die stärkste Kraft in Umfragen und das Land tief gespalten ist“.
2017 erschien Palmers Buch mit dem Titel „Wir können nicht allen helfen“, in dem er für eine Kontrolle der Grenzen bis zur Abschiebung von Straftätern in Krisengebiete plädierte. Der Aufschrei war enorm. Heute sieht er sich ganz auf der Linie der Regierungspolitik und fragt ketzerisch: „Haben andere umgedacht?“
Palmer spricht von „viel zu vielen Fehlern in zu kurzer Zeit“. Man habe „die materielle und mentale Integrationskraft unserer Gesellschaft einschließlich der hier lebenden Migranten überstrapaziert“. Und die Folgen seien gravierend. Während sich mittlerweile erste Erfolge auf dem Arbeitsmarkt einstellten, bestünde im Bildungssystem und auf dem Wohnungsmarkt eine dauerhafte Überlastung, „deren Überwindung mindestens ein weiteres Jahrzehnt braucht“. Am schlimmsten aber sei „die Leugnung und Tabuisierung der Probleme, besonders bei Gewalt und schweren Straftaten“. Dadurch habe die AfD freie Bahn erhalten „als anscheinend einziger Sachwalter von Recht und Ordnung“.
Was man hätte besser machen können? Für den 53-Jährigen ist die Antwort einfach: „Es hätte eigentlich genügt, die Meldungen und Vorschläge der Praktiker in den Kommunen ernst zu nehmen.“
Michael Wolffsohn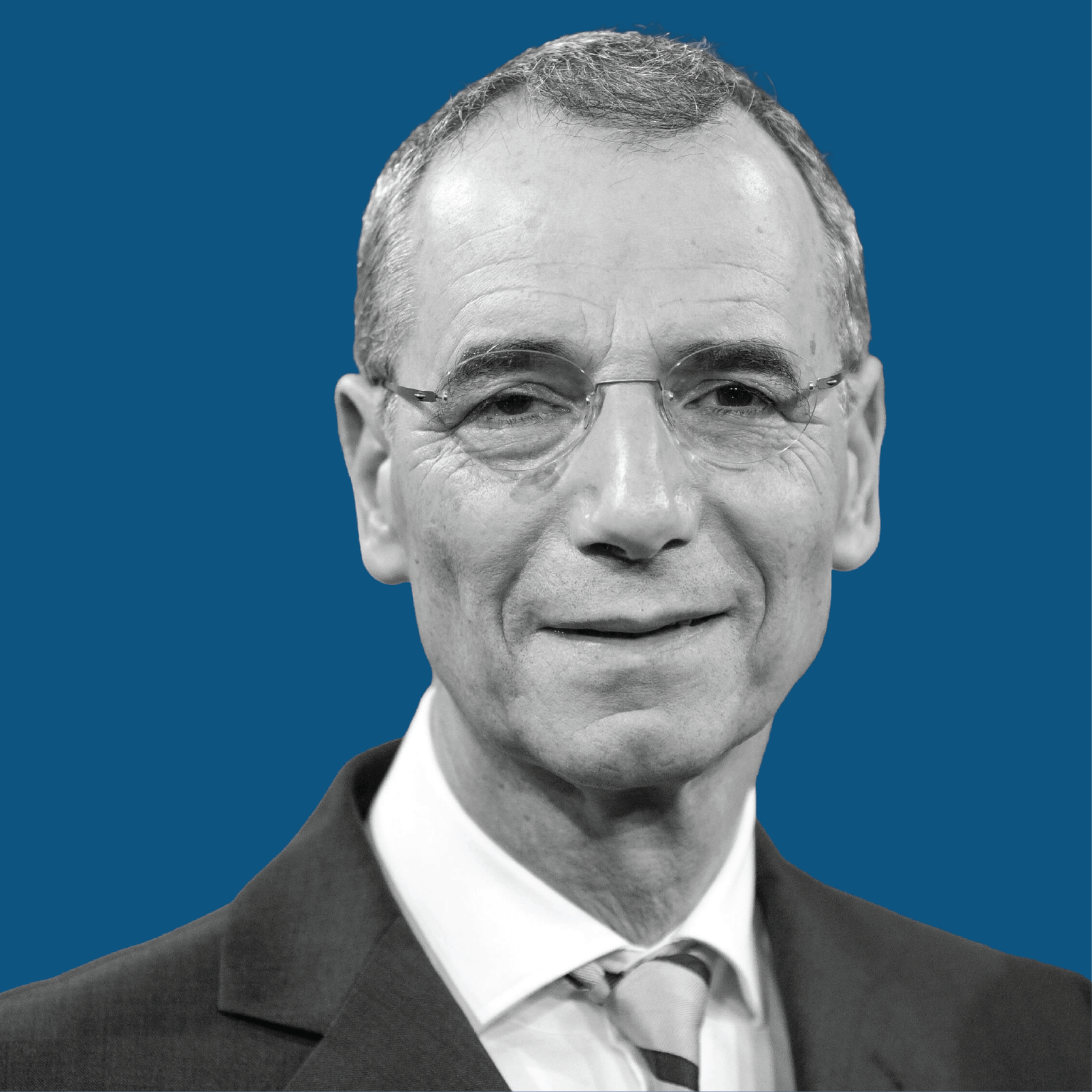
Der Historiker und Publizist Michael Wolffsohn nannte 2015 die Migration ein „Geschenk des Himmels“. Unter anderem konstatierte er ein „demografisches Defizit“. Damit meinte er die alternde Gesellschaft. Für Wolffsohn war klar: „Darum werden wir unseren Lebensstandard auf Dauer nicht halten können. Jetzt kommen die vielen Flüchtlinge. Das mag manchen gefallen und manchen nicht. Aber sie lösen das schwerwiegende demografische Problem der Bundesrepublik. Zumindest mildern sie es.“
Der 78-Jährige steht bis heute zu dieser Haltung, „denn das demografische Defizit in Deutschland ist offenkundig“. Er habe freilich nicht ahnen können, „dass die politische Steuerung dabei nahezu total versagen würde“. Wolffsohn betont, dass er nie gesagt habe, dass man jeden Bewerber ungeprüft reinlassen dürfe. „Es gab klare Hinweise, dass auch potenzielle Terroristen eingeschleust würden. Darauf hatte ich auch aufmerksam gemacht.“
Wolffsohn wurde in Tel Aviv in eine jüdische Familie geboren, die bereits 1954 nach West-Berlin ging, wo er aufwuchs. Zu Merkel fällt ihm dies ein: „Ich sag’s auf Berlinisch: Große Klappe, nüscht dahinter. Luftschlösser – nicht nur auf diesem Gebiet.“
Die deutsche Flüchtlingspolitik ab 2015 beschreibt der Geschichtsprofessor der Universität der Bundeswehr in München als „gutgläubig“, als „sehr sympathisch, aber leider naiv“. In Theorie und Praxis von Migration und Integration sei diese Politik komplett inkompetent gewesen – für Wolffsohn ein „Symptom für die allgemein mangelnde Professionalität in unserem Land“. Sein dringender Ratschlag: „Reflect before you act!“ Erst nachdenken, dann handeln.
Sigmar Gabriel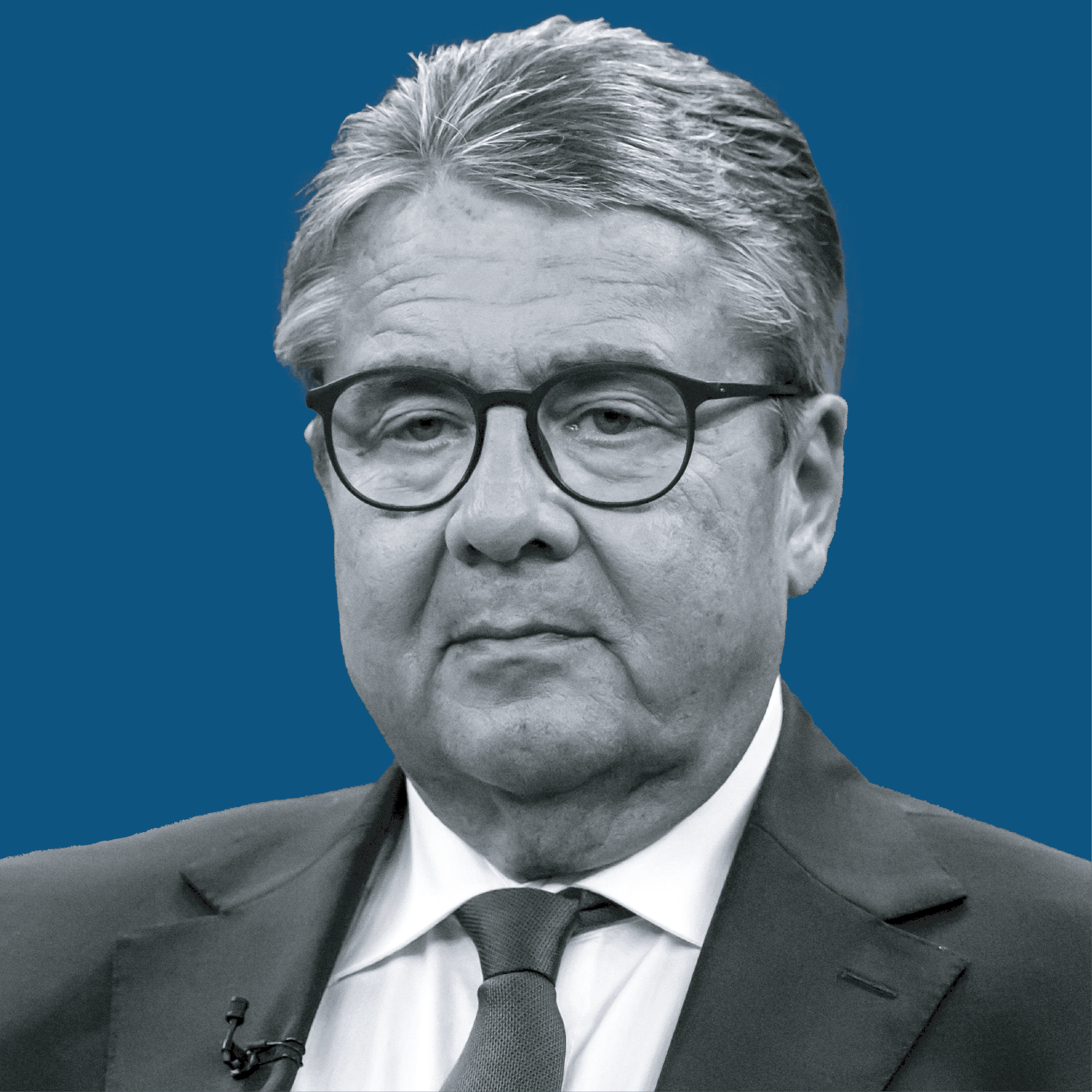
Sigmar Gabriel, damals SPD-Chef und Vizekanzler, stand 2015 klar hinter der Entscheidung, Geflüchtete, die zu Tausenden an der österreichischen Grenze warteten, aufzunehmen. „Wir konnten unsere Nachbarn nicht alleinlassen“, sagt er rückblickend der Berliner Zeitung und betont, dass ein Land mit 82 Millionen Einwohnern grundsätzlich mit Hunderttausenden, ja sogar mit einer Million Menschen hätte umgehen können. Entscheidend sei aber nicht die Zahl gewesen, sondern die Frage, ob Integration in so kurzer Zeit gelingen könne.
Heute zieht Gabriel eine kritische Bilanz: „Rückblickend muss man sagen, das ist uns nicht ausreichend gelungen.“ Die Geschwindigkeit und die schiere Menge der Ankommenden hätten Deutschland überfordert. Hätte man dieselbe Zahl über einen längeren Zeitraum verteilt, wäre es leichter gewesen. Ein zentraler Fehler sei gewesen, dass die Politik die eigene Bevölkerung nicht ausreichend mit einem „Solidarpaket“ unterstützte. „Niemanden vergessen, wäre vielleicht der bessere Schlachtruf gewesen als ‚Wir schaffen das‘“, resümiert Gabriel.
Das Interview mit Sigmar Gabriel lesen Sie hier:Zudem kritisiert er manche Illusionen jener Zeit, etwa den Glauben, das Fachkräfteproblem sei durch die Flüchtlinge lösbar. Viele seien ohne ausreichende Qualifikationen gekommen, 20 Prozent waren sogar Analphabeten. Für erfolgreiche Integration wären massive Investitionen in Sprachkurse und Schulen nötig gewesen – „statt zu klotzen, wurde gekleckert“. Auch deshalb sieht Gabriel die damalige Politik kritisch. Trotzdem erinnert er sich an die enorme Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung als „wunderbares Erlebnis“: Deutschland, einst ein Land der Angst und des Schreckens, sei für viele zum Sehnsuchtsort geworden.
Wird die aktuelle Bundesregierung es schaffen, und sollte sie sich Donald Trumps Migrationspolitik zum Vorbild nehmen? Dazu äußert sich Sigmar Gabriel ausführlich im Interview mit der Berliner Zeitung.
Heinrich Bedford-Strohm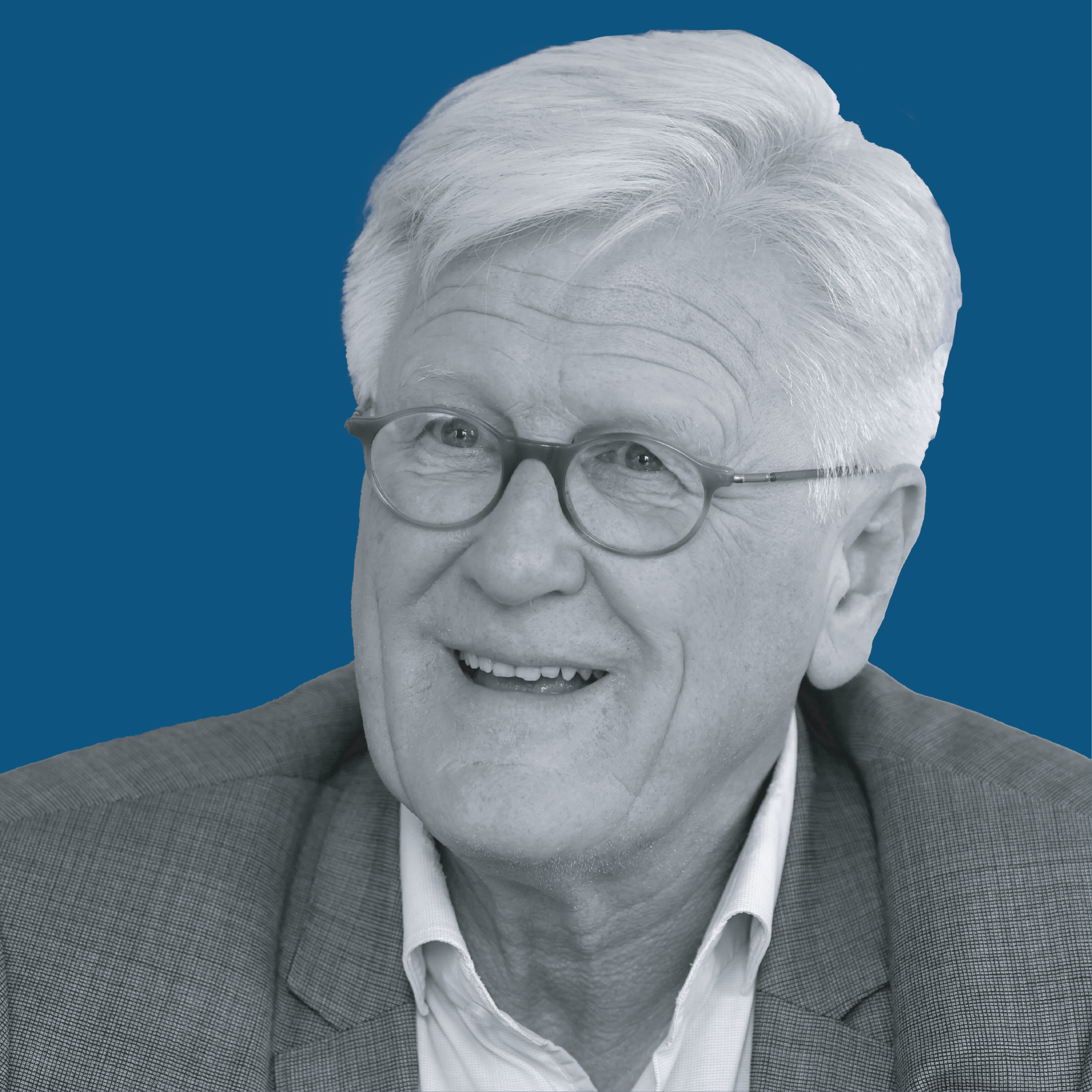
Zum Zeitpunkt von „Wir schaffen das“ war Heinrich Bedford-Strohm nicht nur Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, sondern auch Ratsvorsitzender der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. In dieser Eigenschaft hat er sich immer wieder zur Flüchtlingswelle, ihren Herausforderungen und ihren Chancen für die Aufnahmegesellschaft geäußert. Unter anderem sagte der gebürtige Allgäuer, Europa habe in der Flüchtlingskrise die Chance, „eine neue Menschlichkeit zu zeigen. Wer das schlechtredet, hat unser Grundgesetz nicht verstanden.“
Zehn Jahre später ist der mittlerweile 65-Jährige Vorsitzender des Weltkirchenrats. Zu seiner damaligen Haltung steht er noch heute: „Es ging um Humanität und Menschenwürde. Wie könnten wir davon abrücken?“ Aus seiner Sicht habe Deutschland damals „sein bestes Gesicht gezeigt“. Es wäre unwürdig gewesen, die Flüchtlinge zwischen den Länder Europas hin und her zu schieben.
Merkels „Wir schaffen das“ hält Bedford-Strohm weiterhin für einen starken Satz. Mehr noch: „Es war genau der richtige Satz. Genau der Satz, den man von einer Kanzlerin erwarten muss.“ Wenn man vor besondere Herausforderungen gestellt sei, müssten die Spitzen der Politik Mut machen, sie zu bestehen. Alles andere wäre verantwortungslos gewesen. Und der Theologe stellt noch etwas anderes fest: „Es war grandios, wieviele Menschen mitgeholfen haben, dass Deutschland diese Herausforderung an die Humanität bestanden hat.“
Doch der Kirchenmann weiß natürlich auch um die Schwierigkeiten. Es habe lange gedauert, „bis das Registrierungschaos überwunden war“, sagt er. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass er es für jetzt überwunden hält.
Zwei Fehler sieht Bedform-Strohm bis heute: So wollten sich Geflüchtete nützlich machen und teilhaben, doch die Hindernisse für die Arbeitsaufnahme seien viel zu hoch. Bis heute. „Ich habe viele absurde Situationen als Bischof erlebt, wenn Menschen, die hier dringend gebraucht wurden, wegen der mangelnden Flexibilität des Asylrechts abgeschoben werden sollten. Nur manchmal konnte die Abschiebung verhindert werden.“
Der andere Fehler sei „eine populistische Stimmungsmache gegen Geflüchtete“ gewesen, die ausländerfeindliche Haltungen nicht entkräftet, sondern noch verschärft hätten. Für ihn bleibt am Ende, dass „wir aufhören sollten, alles immer niederzureden, und stattdessen von guten Beispielen lernen und sie nachmachen“.
Gregor Gysi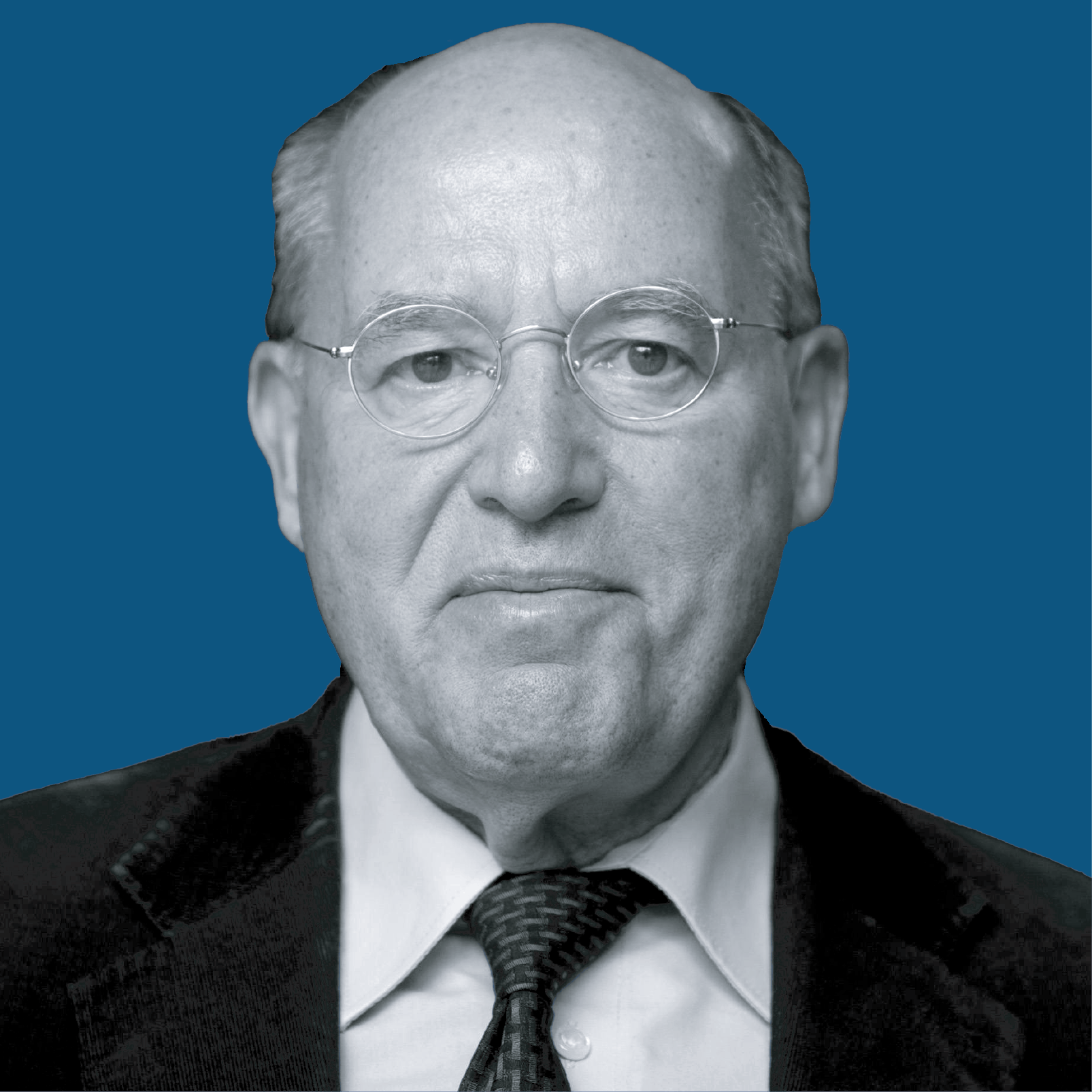
Als die Bilder von überfüllten Bahnhöfen, jubelnden Helfern und ankommenden Flüchtlingen im Spätsommer 2015 um die Welt gingen, war Gregor Gysi eine der lautesten Stimmen in der deutschen Politik, die das Geschehen positiv begleiteten. Der damalige Fraktionschef der Linken im Bundestag argumentierte aus einer klar humanistischen Haltung heraus: Er lobte die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung, erinnerte daran, dass Deutschland seit jeher von Einwanderung geprägt sei, und formulierte Sätze wie diesen: „Deutschland ohne Einwanderer – das ist wie Oktoberfest ohne Dirndl.“ Gleichzeitig mahnte er schon damals, dass es Aufgabe des Staates sei, die strukturellen Probleme zu lösen.
Zehn Jahre später blickt Gysi differenzierter auf diese Zeit zurück, ohne indes seine Grundüberzeugung aufzugeben. „Im Kern stehe ich zu meinen damaligen Aussagen. Der humanistische Gehalt bleibt“, sagt er der Berliner Zeitung. Doch er benennt auch Fehler, die seiner Ansicht nach das politische Klima und den gesellschaftlichen Zusammenhalt nachhaltig belastet hätten.
So sei es ein gravierendes Versäumnis gewesen, dass in der Hochphase der Flüchtlingskrise Sicherheitsprüfungen vorübergehend aufgehoben wurden: „Das war zweifellos ein Fehler, denn vorher hatten wir keine Anschläge.“ Auch die fehlende Unterstützung der Kommunen habe erheblich zur Spaltung beigetragen: Viele Menschen hätten den Eindruck gewonnen, der Staat lasse sie allein.
Besonders kritisch sieht Gysi die Integrationspolitik. Viel zu oft seien Geflüchtete über Monate in Zelten untergebracht worden, ohne Arbeitserlaubnis und ohne ausreichende Sprachförderung. „Entweder saßen sie elend lange in Zelten rum und durften nicht arbeiten, oder sie wurden wieder zusammenhängend in einem Wohnblock untergebracht, so dass Parallelgesellschaften entstehen müssen.“
Seine „Wir schaffen das“-Bilanz fällt daher ambivalent aus. Zwar hält Gysi an dem humanitären Anspruch fest, doch gleichzeitig sieht er in den politischen Versäumnissen die Ursache dafür, dass der einstige Aufbruch in eine tiefe gesellschaftliche Spaltung mündete.
Mario Czaja
Mario Czaja hatte sich 2015 mit der Bewertung von Angela Merkels „Wir schaffen das“ zurückgehalten. Die Begründung dafür ist einfach: Er hatte, wie die anderen Mitglieder des damaligen Senats, alle Hände voll damit zu tun, die tausenden Neuankömmlinge in der Stadt zu registrieren, zu versorgen und unterzubringen. Für den Politiker Czaja brachte die Zeit besondere Herausforderungen mit sich. Als Gesundheitssenator war er auch für das Landesamt für Gesundheit und Soziales zuständig, das Lageso – damals so etwas wie das Synonym dafür, dass „wir“ es zumindest nicht in Gänze und überall „schafften“. Vor dem Amt in Moabit spielten sich katastrophale Szenen ab, weil Berlin auf solch einen Ansturm nicht vorbereitet war. Und Czaja war der ärmste Hund, der die Prügel dafür einsteckte und seine Politikerkarriere fast vor die Wand fahren sah. Auch wenn er selbst das nie so ausdrücken würde.
Lesen Sie das Interview mit Mario Czaja hier:In der Rückschau sagt der 49-Jährige aus Marzahn-Hellersdorf im Interview mit der Berliner Zeitung, dass er viele Kritik an der Politik seiner Parteifreundin und Bundeskanzlerin „auch für gerechtfertigt halte“. Dennoch könne er bis heute nachvollziehen, dass Angela Merkel sich damals dazu entschlossen hatte, die 10.000 bis 15.000 syrischen Flüchtlinge, die in Budapest festsaßen, aufzunehmen. „Das kann ich vor allem vor dem Hintergrund, mit wieviel Sympathie die Ostdeutschen auf Ungarn und Budapest blickten und heute noch blicken, nachvollziehen.“ Nur leider habe das dazu geführt, dass sich viele andere europäische Länder wegduckten und am Ende Deutschland alleine etwa 50 Prozent der Flüchtlinge aufnehmen musste.
Czaja sagt zudem, dass „die Grenzen des Schaffbaren erreicht und an vielen Stellen überschritten“ wurden. „Die Handlungsfähigkeit des Staates war nicht mehr vorhanden und ist auch heute in Teilen nicht vorhanden.“ Besonders kritisch sei, „dass die objektiven Probleme nicht angesprochen werden konnten beziehungsweise durften. Das Benennen objektiver Probleme galt als nicht gesellschaftsfähig“.
Friedrich Merz, dem er anderthalb Jahre als Generalsekretär der Bundes-CDU diente, stellt Czaja in Sachen aktuelle Migrationspolitik ein gutes Zeugnis aus. „Es ist richtig, die Grenzen zu sichern, um illegale Migration zu begrenzen. Wir spüren ja schon, dass es wirkt. Die Zahlen gehen zurück, das heißt, dass die Handlungsfähigkeit des Staates zurückkehrt.“
Zu den dramatischen Wochen des Jahres 2015 in Berlin, den Zuständen am Lageso und was Berlin daraus gelernt habe, äußert sich der damalige Gesundheitssenator Mario Czaja in einem Interview in der Berliner Zeitung.
Berliner-zeitung

